4. Gesundheitsberichterstattung Handwerk
► Inhaltsverzeichnis Kapitel (ausklappbar)
„Ich hab’ echt nie verstanden, was an GBE schwer sein soll. Ein paar Daten zusammenrühren, schön bunt machen, ein bisschen texten und raus damit. Hab ja auch noch andere Aufgaben.“
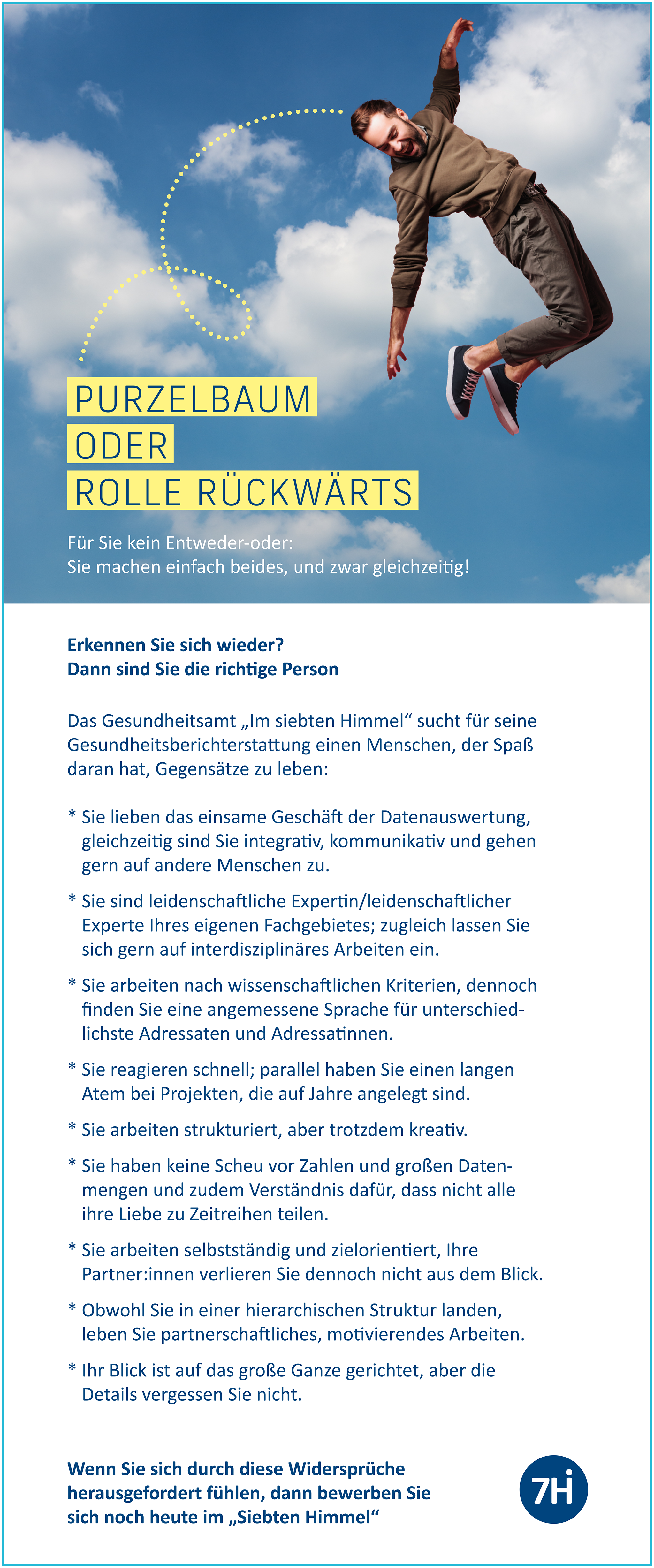
Diese Stellenbeschreibung ist natürlich bewusst überspitzt formuliert. Dennoch enthält sie viele Körnchen Wahrheit, denn als Gesundheitsberichterstatter und Gesundheitsberichterstatterin kommt man sich tatsächlich manchmal vor wie die berühmte eierlegende Wollmilchsau. GBE erfordert viele Fähigkeiten, die oftmals im Widerspruch zueinander stehen und auch im Studium nicht immer vermittelt werden (können). Um nicht zwischen Widersprüchen und Ansprüchen zerrieben zu werden, gibt es Handwerkszeug für eine gute GBE. Das folgende Kapitel soll hier einen ersten Einblick geben.
4.1. Datengrundlagen der Gesundheitsberichterstattung

Gesundheitsberichterstattung arbeitet zumeist mit sogenannten Sekundärdaten. Als Sekundärdaten bezeichnet man Daten, die in anderen Zusammenhängen entstanden bzw. die für andere Zwecke erhoben worden sind. Beispiele sind amtliche Statistiken wie Bevölkerungsstatistiken, die Todesursachenstatistik oder die obligatorischen Statistiken der Gesetzlichen Krankenversicherung (KV 45, KJ 1, KM 1, weitere Informationen unter: Link) und der Krankenhäuser. Zu den für die GBE nutzbaren Sekundärdaten zählen auch Registerdaten (zum Beispiel Krebsregister, Herzinfarktregister) sowie Routinedaten und prozessgenerierte Daten. Routinedaten bzw. prozessgenerierte Daten sind Informationen, die Behörden, Organisationen und Unternehmen im Zuge ihrer Aktivitäten erheben. Bekannte Beispiele sind die Daten aus den Schuleingangsuntersuchungen der Gesundheitsämter oder die gemäß dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) erhobenen Informationen. Auch die Daten der Sozialversicherungen und der Kassenärztlichen Vereinigungen können für die Gesundheitsberichterstattung von Bedeutung sein. Weitere Datenquellen für die Gesundheitsberichterstattung sind wissenschaftliche Studien, beispielsweise die Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS), die häufig als sogenannte Public-Use-Files zur Verfügung stehen (Weiteres hierzu auch in Kapitel 6). Public-Use-Files sind Daten, die von verschiedenen Instituten der Forschungsinfrastruktur für öffentliche und/oder wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Sie können für eigene statistische Auswertungen genutzt werden, um zu neuen, für den Berichtsgegenstand relevanten Erkenntnissen zu gelangen.
Für die Nutzung von Sekundärdaten sprechen in erster Linie forschungsökonomische Überlegungen: Sekundärdaten müssen nicht erst mühsam erhoben werden, sondern liegen schon aufbereitet in auswertbarer Form vor. Idealerweise wurden sie standardisiert erfasst, man kann also in der Regel eine gewisse Datenqualität unterstellen. Dies gilt insbesondere für Survey-Daten.
Eine wichtige Datenbank, in der viele Datenquellen für Deutschland und die Bundesländer zu finden sind, ist die Datenbank der Bundesgesundheitsberichterstattung, online unter www.gbe-bund.de. Dort sind einzelne Sachverhalte über Suchbegriffe wie in einer Suchmaschine recherchierbar und die Tabellen oft nach den eigenen Bedürfnissen veränderbar. Allerdings sind dort bisher keine Daten auf Kreisebene abrufbar. Diese muss man zum Beispiel in den Sammlungen von Gesundheitsindikatoren der Länder suchen, auf der Webseite www.regionalstatistik.de, betrieben von den statistischen Landesämtern, oder in den jeweiligen Originalquellen. Gesundheitsberichterstattung ist immer auch ein Suchen und Finden.
Eine weitere wichtige Datenbank ist die Datenbank INKAR des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, online unter www.inkar.de. Hier sind bis auf Kreisebene viele auch für die Gesundheitsberichterstattung relevante Daten abrufbar, vor allem zu sozialen, ökonomischen oder siedlungsstrukturellen Merkmalen. Es gibt auch einige Gesundheitsindikatoren, unter anderem sind hier Daten zur Lebenserwartung auf Kreisebene zu finden, die es in der amtlichen Statistik sonst nicht gibt.
4.1.1. Datenquellen der Gesundheitsberichterstattung
Einige wichtige Datenquellen der Gesundheitsberichterstattung werden im Folgenden kurz vorgestellt:
Die Todesursachenstatistik ist eine der häufig genutzten Datenquellen der Gesundheitsberichterstattung. Sie gehört zur amtlichen Statistik, also zu den durch Gesetz geregelten und den statistischen Ämtern übertragenen Statistiken. Gesetzliche Grundlage der Todesursachenstatistik in Deutschland ist das Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (Bevölkerungsstatistikgesetz). Die Todesursachenstatistik wird in Deutschland seit mehr als 100 Jahren erhoben und liegt nach Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation in ähnlicher Form auch international vor. In der Todesursachenstatistik wird nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten (ICD) codiert (www.dimdi.de). Dabei wird in Deutschland derzeit noch eine monokausale Todesursachenstatistik geführt: In der Statistik wird das Grundleiden codiert, also die Krankheit, die medizinisch ursächlich für den Tod ist. Das ist häufig nicht der unmittelbar den Tod auslösende Befund. Grundlage der Todesursachenstatistik sind die ärztlichen Eintragungen auf der Todesbescheinigung. Sie werden von den Standesämtern über die Gesundheitsämter an die Statistischen Landesämter übermittelt. Es ist vorgesehen, auch in Deutschland eine multikausale Todesursachenstatistik einzuführen, in der alle Eintragungen auf der Todesbescheinigung zur Kausalkette der Todesursachen genutzt werden. Darüber hinaus gibt es das Bestreben, die Validität der Todesursachenstatistik weiter zu verbessern sowie die Latenz zur Bereitstellung der Daten zu verkürzen (Eckert, Vogel 2018). Die Daten lassen sich nach Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Wohnort differenzieren. Sie liegen auf Kreisebene und zum Teil auch noch kleinräumiger vor. Eine für die Gesundheitsberichterstattung gravierende Einschränkung der Aussagekraft der Todesursachenstatistik besteht darin, dass sie keine Angaben zum Sozialstatus der Verstorbenen enthält.
Auch die Krankenhausstatistik ist eine amtliche Statistik. Rechtliche Grundlage ist hier die Krankenhausstatistik-Verordnung. Die Diagnosedaten sind wie bei der Todesursachenstatistik ICD-codiert und dokumentieren die Hauptbehandlungsdiagnose. Sie sind ebenfalls nach Alter und Geschlecht sowie nach Wohnort und Behandlungsort differenzierbar. Auch diese Daten liegen auf Kreisebene vor. In der Krankenhausdiagnosestatistik werden Behandlungsdiagnosen geführt. Das bedeutet, dass Mehrfachbehandlungen einer Diagnose eines Patienten/einer Patientin mehrfach innerhalb eines Kalenderjahres gezählt werden können. Darüber hinaus liefert die Krankenhausstatistik wichtige Strukturdaten über die Krankenhäuser, zum Beispiel über Bettenzahlen, Liegedauer oder das Personal der Krankenhäuser, dies jedoch meist nicht bis auf die Kreisebene herab. Neben der amtlichen Krankenhausstatistik gibt es auch Krankenhausdaten aus der DRG-Statistik (DRG=Diagnosis Related Groups), der fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik aus dem Abrechnungssystem der Krankenhäuser. Allerdings sind die DRG-Daten auf kommunaler Ebene nicht routinemäßig über die Statistischen Landesämter verfügbar.
Bei der Berichterstattung zur Kindergesundheit sind die Daten der Schuleingangsuntersuchungen eine wichtige Datenquelle. Sie werden von den Gesundheitsämtern selbst erhoben. Allerdings liegen sie in länderspezifischer Form vor, das heißt, es gibt kaum zwischen den Bundesländern vergleichbare Daten aus den Schuleingangsuntersuchungen. Der Merkmalskatalog umfasst in der Regel Angaben zur Seh- und Hörfähigkeit der Kinder, zu den motorischen Fähigkeiten, ihrer geistigen Entwicklung, der Sprachfähigkeit sowie zu Gewicht und Größe. Auch der Impfstatus der Kinder wird in den Schuleingangsuntersuchungen dokumentiert. In manchen Bundesländern werden zusätzlich sozialstrukturelle Merkmale sowie Angaben zur Lebenssituation und zum Migrationshintergrund erhoben. Im Idealfall lassen sich anhand dieser Daten Assoziationen zu Gesundheit und sozialer Lage (der Eltern) schon im Kindesalter zeigen. Die Daten der Schuleingangsuntersuchungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie für eine wichtige biografische Phase der Kindheit optimalerweise einen vollständigen Jahrgang erfassen. Außerdem sind es Daten, die das Gesundheitsamt selbst erhebt, deren Aussagekraft es also auch gut beurteilen kann. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um Screening-Daten handelt, die den aktuellen Gesundheitszustand nur ausschnittsweise beschreiben können. Der psychische Gesundheitszustand wird zum Beispiel allenfalls in der ärztlichen Anamnese erfasst, jedoch nicht systematisch erhoben. Schuleingangsuntersuchungen bieten die Möglichkeit, für spezifische Fragestellungen zusätzliche (kurze) Frageinstrumente zu integrieren. Darüber hinaus haben sie ein gutes Potenzial für planungsrelevante Analysen unterhalb der Kreisebene und werden vielerorts zum Beispiel im Rahmen einer integrierten Gesundheits- und Sozialberichterstattung dafür genutzt. Kleinräumige Auswertungen dürfen jedoch nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass der Datenschutz der personenbezogenen Daten gewährleistet bleibt und die Kalibrierung der Untersucher und Untersucherinnen es ermöglicht, Untersucher- und Untersucherinneneffekte (das heißt, Muster und Effekte in den Daten, die auf unterschiedliche Handhabungen der Untersucher und Untersucherinnen zurückzuführen sind und somit ein Datenartefakt darstellen) methodisch sauber von räumlichen Effekten abzugrenzen.
Eine weitere wichtige Datenquelle für die Gesundheitsberichterstattung, über die die Gesundheitsämter selbst verfügen, sind die Daten aus dem Meldewesen über Infektionskrankheiten. Das Infektionsschutzgesetz sieht vor, dass für bestimmte Infektionskrankheiten der Verdacht, der Laborbefund oder die Erkrankung meldepflichtig sind. Daran knüpfen sich in der Arbeit des Gesundheitsamtes weitreichende Folgen an, bei einem Masernausbruch in einer Kita beispielsweise Umgebungsuntersuchungen oder bei Infektionen in Lebensmittelbetrieben vielleicht ein Betätigungsverbot für die betroffenen Beschäftigten. Zudem eignen sich die Daten für manche Themen der Gesundheitsberichterstattung. So ist beispielsweise die Entwicklung der Masernzahlen, zusammen mit der Entwicklung der Masernimpfquoten (aus den Schuleingangsuntersuchungen), auch für die breitere Öffentlichkeit von Interesse. Die Daten des Meldewesens unterliegen natürlich strengen Datenschutzanforderungen, es sollen ja nicht einzelne erkrankte Menschen identifiziert und dann womöglich stigmatisiert werden. Zudem ist zu bedenken, dass die Daten auf Meldungen vor allem von Ärztinnen und Ärzten sowie Laboren beruhen. Es sind keine Daten aus epidemiologischen Erhebungen, sie sind mit vielfältigen Selektionseffekten behaftet. Bei den Masern weiß man beispielsweise, dass die Meldedaten das reale Infektionsgeschehen deutlich unterschätzen (Takla et al. 2014).
Eine weitere bedeutende Datengrundlage der Gesundheitsberichterstattung, besonders im Hinblick auf Gesundheitsverhalten und gesundheitliche Ungleichheit, sind die Daten des Gesundheitsmonitorings am Robert Koch-Institut, die sogenannten bundesweiten Gesundheitssurveys. Die Monitoringstudien KiGGS (Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland), DEGS (Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland) und GEDA (Gesundheit in Deutschland aktuell) – um nur ein paar exemplarisch zu benennen – werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt und decken ein großes Themenspektrum ab (Kurth et al. 2009). Neben Prävalenzschätzungen sind auch Analysen zu Zusammenhängen zwischen Gesundheitsoutcomes und zahlreichen Determinanten möglich. Mehr Informationen zu den Gesundheitssurveys findet sich auch auf der Website des Robert Koch-Instituts (Link). Zunehmend wird in den Gesundheitssurveys die Diversität der Gesellschaft besser abgebildet, beispielsweise durch die verstärkte Einbindung von Älteren und Hochaltrigen (RKI 2019) oder Menschen mit Migrationshintergrund (Santos-Hövener et al. 2019).
4.1.2. Datenerhebungen
Für viele Berichtsthemen sind Sekundärdaten vollkommen ausreichend, manchmal jedoch decken sie nicht alle Aspekte eines Berichtsthemas ab. In solchen Fällen muss der/die Berichterstattende die fehlenden Informationen selbst erheben oder versuchen, neue Datenquellen zu akquirieren.
Bei eigenen Erhebungen nutzt die Gesundheitsberichterstattung das methodische Instrumentarium der empirischen Sozialforschung. In aller Regel ist dies die standardisierte (quantitative) Befragung. Einen allgemein verständlichen Überblick über die Methoden der empirischen Sozialforschung gibt Diekmann (2014). In der empirischen Sozialforschung lassen sich zwei methodologisch unterschiedliche Positionen unterscheiden: zum einen der quantitative Forschungsansatz, dessen Wurzeln in der naturwissenschaftlichen Erkenntnistheorie liegen und der eher standardisierte Verfahren zur Prüfung von Hypothesen nutzt, zum anderen der qualitative Ansatz, dessen Wurzeln in der Ethnologie und in der frühen stadtsoziologischen Forschung liegen und der eher rekonstruktive Verfahren zur Bildung von Theorien nutzt. Eine strikte Trennung der beiden Untersuchungsansätze ist oftmals nicht möglich, da es häufig Überlappungen gibt. In der Gesundheitsberichterstattung als auch in der Gesundheitsforschung allgemein dominiert der quantitative Ansatz. Studien, in denen qualitative Methoden eine Rolle spielen, sind bislang die Ausnahme.
Seit einiger Zeit wird in der Gesundheitsberichterstattung verstärkt über die Nutzung qualitativer Verfahren diskutiert. Daher seien an dieser Stelle kurz die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Forschungsansätzen beschrieben. Kennzeichnend für den quantitativen Ansatz ist die strikte Trennung zwischen Forschenden und Beforschten, der Einsatz standardisierter Erhebungsinstrumente in kontrollierten Erhebungssituationen sowie das Erreichen möglichst großer Fallzahlen, um innerhalb vertretbarer Fehlergrenzen durch statistische Auswertungen allgemeingültige Aussagen zu gewinnen. Um begründen zu können, warum man was erhebt, setzt dieser Ansatz allerdings ein Mindestmaß an Vorwissen über den Untersuchungsgegenstand voraus. Demgegenüber versucht der qualitative Ansatz ausdrücklich, die subjektiven Sichtweisen der Beforschten kennenzulernen und daraus ableitbare Handlungen zu verstehen. Dies erfordert eine offene Herangehensweise mit möglichst wenig standardisierten Methoden wie (teilnehmender) Beobachtungen oder offenen Interviews. Das dabei gewonnene umfangreiche Datenmaterial – Videos, Beobachtungsprotokolle oder transkribierte Interviewtexte – wird anschließend aufwendig analysiert. Von daher basieren qualitative Studien höchstens auf einigen Dutzend Fällen. Wegen des offenen, teilweise intuitiven Vorgehens und der geringen Fallzahlen wird die Validität der Ergebnisse qualitativer Studien jedoch häufig angezweifelt.
Die jeweiligen Stärken beider Ansätze lassen sich innerhalb von Mixed-Methods-Designs nutzen. Aufgrund ihrer Offenheit eignen sich qualitative Verfahren insbesondere zur Gewinnung neuer Erkenntnisse und zur Generierung von Hypothesen, die anschließend mithilfe quantitativer Verfahren geprüft werden können. Unter anderem wegen des damit verbundenen Aufwands ist dies im Forschungskontext häufiger als in der GBE gefragt.
4.1.3. Indikatoren in der Gesundheitsberichterstattung
„The wisdom, justice, and perceived legitimacy of public decisions are crucially affected by the quality of the information on which they are based“ (Institute of Medicine (U.S.) 1988).
Daten sprechen nicht für sich allein und müssen entsprechend transformiert sowie aufbereitet werden, um als Planungsgrundlage für (gesundheits-)politische Entscheidungen zu dienen. In der GBE greift man hierzu vielfach auf (Gesundheits-)Indikatoren zurück. Möchte man beispielsweise die Sterblichkeit infolge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in einer bestimmten Region auswerten, könnte sich hierfür die Anzahl der Herz-Kreislauf-Todesfälle je 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen in einem bestimmten Zeitraum als Indikator eignen. Indikatoren sind Maßzahlen, die durch die Angabe einer oder mehrerer Bezugseinheiten gekennzeichnet sind und deren Berechnung standardisiert ist, um Vergleiche zu ermöglichen. Häufig werden Indikatoren nach verschiedenen bevölkerungsbezogenen, räumlichen oder auch zeitlichen Bezugseinheiten variiert (Hamburger Projektgruppe Gesundheitsberichterstattung 1998). Diese Kontextualisierung von Daten und Indikatoren stellt somit die Informationsbasis der Gesundheitsberichterstattung dar, wie in der nachfolgenden Abbildung veranschaulicht:

Oft dienen Indikatoren als Marker für die gesundheitliche Lage, Ressourcen und Leistungen im Gesundheitswesen und ermöglichen auf diese Weise ein kontinuierliches Monitoring von Programmen, Zielen und Maßnahmen (AOLG 2003). Dabei liefern Indikatoren ein Maximum an Informationsverdichtung zu einem bestimmten Interessensgebiet und umfassen häufig auch Interessensbereiche für (politische) Maßnahmen oder dienen der (politischen) Zielsetzung. Ein Beispiel: Ein kommunales Gesundheitsziel zielt darauf ab, den prozentualen Anteil jugendlicher Raucherinnen und Raucher auf weniger als 20 % zu reduzieren. Indikatoren sollten dies auf möglichst effiziente Weise darstellen, das heißt eine möglichst einfache Darstellung liefern (Kramers 2005, zit. nach Verschuuren et al. 2014). Traditionell wird hierzu auf numerische Darstellungsformen zurückgegriffen, in den letzten Jahren finden aber auch zunehmend visuelle Aufbereitungen Anklang. Ziel und Zweck einer indikatorengestützten Gesundheitsberichterstattung ist die kompakte Darstellung (gesundheits-)relevanter Themen um Informationsdefiziten entgegenzuwirken, Problem- sowie Optionsfelder aufzuzeigen und prioritäre gesundheitspolitische Entscheidungshilfen zu unterstützen. Im Idealfall kann die indikatorengestützte Berichterstattung somit eine evidenzinformierte Entscheidungsfindung unterstützen.
Als Grundlage für Gesundheitsrahmenberichte der Länder wurde bereits vor dem Aufbau einer nationalen Gesundheitsberichterstattung im Jahr 1991 die erste Version eines Indikatorensatzes für die Gesundheitsberichterstattung der Länder mit 190 Indikatoren veröffentlicht. Fünf Jahre später wurde nach ersten Erfahrungen eine überarbeitete und gekürzte Version verabschiedet. Die Veröffentlichung der bis heute gültigen dritten Version des Indikatorensatzes erfolgte 2003 auf Beschluss der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG 2003) und im Auftrag der Gesundheitsministerkonferenzen (Bardehle et al. 2004). Die insgesamt 297 Indikatoren des Indikatorensatzes verteilen sich auf die Themenfelder Bevölkerung, wirtschaftliche und soziale Lage; Morbidität und Mortalität; Gesundheitsverhalten; Gesundheitsrisiken aus der natürlichen und technischen Umwelt; Einrichtungen des Gesundheitswesens; Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsversorgung; Beschäftigte und Ausbildung; Ausgaben und Kosten im Gesundheitswesen. Zu jedem Indikator gibt es eine kurze Metadatenbeschreibung, die Auskunft gibt zum Beispiel über Datenquellen, Periodizität und Aussagekraft. Bis zu 80 Indikatoren (je nach Land) liegen auch auf Kreisebene vor. Die Indikatoren werden fortlaufend aktualisiert und durch länderspezifische Ergänzungen erweitert. Zurzeit wird ein ergänzendes Indikatorensystem für die Präventionsberichterstattung der Länder entwickelt (siehe auch Kapitel 8).
In der Europäischen Union sowie auf nationaler Ebene wird häufig der Europäischen Kernindikatorensatz für Gesundheit (European Core Health Indicators, ECHI) verwendet. Die ECHI-Indikatoren bilden Eckpunkte ab zu den Themen Demografie, sozioökonomische Lage, Gesundheitszustand, Gesundheitsdeterminanten, Versorgung und Gesundheitsförderung. Neben den Indikatoren mit ihrer Definition wurden ebenfalls Metainformationen wie empfohlene Datenquellen und Datentyp, Verfügbarkeit, Vergleichbarkeit erarbeitet (Verschuuren et al. 2014).
4.2. Ergebnisdarstellung
4.2.1. Formate der GBE
Traditionell wird in der GBE zwischen Basis- und Spezialberichten unterschieden. Basisberichte haben den Anspruch, die gesundheitliche Lage der Bevölkerung umfassend darzustellen. Spezialberichte widmen sich fokussiert einem Thema – wie Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, Sucht, Armut etc. Beispiele unterschiedlicher kommunaler Gesundheitsberichte sind etwa in der nordrhein-westfälischen Datenbank Kommunale GBE gelistet und verschlagwortet (www.lzg.nrw.de).
Zu den Produkten der GBE können jedoch nicht nur Berichte gezählt werden. Zur Produktpalette der GBE gehören auch regelmäßig gepflegte und online zur Verfügung gestellte Indikatorensysteme, Metadaten, Grafiken und interaktive Gesundheitsatlasangebote oder Dashboards (zum Beispiel das Sozialmonitoring Stuttgart).
Auch das eigentliche Berichtsformat kann nicht mehr nur als klassischer Printbericht verstanden werden: Kurzberichte, Factsheets, online dargestellte, erläuterte und zum Teil auch gestaltbare Inhalte, spezielle Aufbereitungen wie Policy Briefs (prägnante Zusammenfassungen, oft mit eigenständigen Analysen und Handlungsempfehlungen), Präsentationen für Fachausschüsse, Stellungnahmen etc. weisen Eigenschaften der Berichterstattung auf, indem sie faktenbasiert die gesundheitliche Lage darstellen.
Je nach Ressourcenverfügbarkeit und kommunalem Kontext sind weitere Formate denkbar, die die Berichterstattung ergänzen können. Hierzu zählen Blogs, Storytelling-Ansätze, Infografiken, Erklärvideos oder animierte Grafiken (zum Beispiel GIFs) zur Vermittlung von Inhalten über Social-Media-Kanäle. Im Rahmen der britischen Anual Report Competition können unter den platzierten Berichten häufig Formate gefunden werden, die mit diesen Formaten experimentieren (www.adph.org.uk).
Zusammenfassend sollten Formate der GBE verschiedene Mechanismen bedienen (Blessing et al. 2017):
-
Push-Mechanismen: adressaten- und adressatinnengerechte Bereitstellung von Wissen in geeigneten Formaten (zusammenfassende Instrumente, Visualisierungen, zum Beispiel in Form von Infografiken oder Karten)
-
Pull-Mechanismen: beispielsweise interaktive Online-Angebote wie Datenzusammenstellungen, Gesundheitsatlanten, Analysetools, die Adressatinnen und Adressaten entsprechend ihrer Bedarfe nutzen Können
-
Linkage-/Exchange-Mechanismen: regelmäßige Foren zum Austausch zwischen Berichterstatterinnen und Berichterstatter sowie Adressatinnen und Adressaten
Auf Bundesebene wurde vom RKI eine Fachzeitschrift für Gesundheitsberichterstattung (www.rki.de/johm) aufgebaut, in der ein Teil der GBE-Ergebnisse veröffentlicht wird (Saß et al. 2018).
4.2.2. Was macht einen Bericht aus?
Die Berichterstellung gehört zu der Wissensebene der Informationspyramide. Diese Ebene gliedert sich weiter auf in inhaltliche Aspekte, den Prozess der Berichterstellung (siehe Kapitel 6) und die Vermarktung des Berichts (siehe Abschnitt 4.3.1.). Eine gute fachliche Orientierung für die Erstellung von Gesundheitsberichten liefert die Kriterienliste im Anhang der Publikation „Gute Praxis Gesundheitsberichterstattung 2.0“. Damit können Berichte bezüglich ihrer Vollständigkeit und der Beachtung aller relevanten Aspekte überprüft werden (Starke et al. 2019).

Die inhaltliche Zusammenstellung des Berichts sollte begleitet sein durch Diskussionen und Überlegungen zur sprachlichen Gestaltung, zur Erzählung (Storyline) des Berichts, dem Zweck, den der Bericht erfüllen soll, dem Umgang mit datenbasierten Unsicherheiten und Limitationen sowie dem Neuigkeitsgehalt des Berichts. Einige dieser Aspekte werden im Folgenden kurz skizziert.
Beim Schreiben des Berichts sollten Stil und Jargon (Sprache) an die Adressatinnen und Adressaten angepasst und beispielsweise Fremdwörter und Fachsprache durch einfachere Begriffe ersetzt werden. Komplexere Inhalte können beispielsweise in einem Glossar näher erläutert werden. Darüber hinaus ist es ratsam, die Erzählung des Berichts nicht aus dem Auge zu verlieren. Der Bericht ist faktenbasiert, im Fokus des Textes sollten aber nicht alle verfügbaren Zahlen zum Thema stehen, sondern der Inhalt an sich.
Damit die Geschichte verständlich und überzeugend bei den Adressatinnen und Adressaten ankommt, ist es empfehlenswert, die Fragen nach dem Warum und dem Und-jetzt zu beantworten. Zur Beantwortung des Warums sollten identifizierte Unterschiede und Trends erläutert werden. Hierdurch werden sie für die Adressatinnen und Adressaten nachvollziehbar. Die Lieferung von Erläuterungen ist häufig nicht allein aus der GBE heraus möglich. Die Hinzuziehung wissenschaftlicher Evidenz kann helfen, Erklärungsansätze für die dargestellten Unterschiede und Trends zu identifizieren. Die Beantwortung der Frage nach dem Und-jetzt? soll mögliche Handlungsoptionen aufzeigen. Dadurch wird der Bericht lösungsorientierter. Hierbei sollte möglichst auf evidenzgesicherte Maßnahmen oder etablierte Good-Practice-Beispiele verwiesen werden (van Bon-Martens et al. 2019; Cornelius-Taylor, Brand 2004). Um die Geschichte passgenau zu vertextlichen, ist es relevant, zu wissen, welche Aufgabe der Bericht erfüllen soll. Beispiele hierzu sind in Kapitel 2 gelistet.
4.2.3. Datenvisualisierung
Grafiken und Karten sind ein fester Bestandteil der GBE, um Verteilungen und Entwicklungen zu visualisieren. Eine gute Datenvisualisierung ist optisch so aufbereitet, dass Muster in den Daten erkennbar sind. Datenvisualisierungen sollten ansprechend und klar sein, nicht manipulieren und nur relevante Details darstellen (Cairo 2016). Die richtige Form der Visualisierung zu finden, kann genauso aufwendig sein, wie Muster durch eine vertiefende Datenanalyse zu identifizieren (Nussbaumer Knaflic 2015). Dabei sind im ersten Schritt einige einfache Grundregeln zu beachten (Cairo 2016; Few 2012):
-
Als Grafikformate sollten Balken, Säulen, Boxen, Punkte oder Linien gewählt werden
-
Da Flächen und Winkel für die Leserinnen und Leser schwieriger zu interpretieren sind, sollten Flächen- oder Tortendiagramme nur in Ausnahmen gewählt werden. Die Länge von Balken, Säulen oder Boxen sowie die 2D-Position von Punkten sind einfacher zu Interpretieren
-
Der darzustellende Zahlenraum sollte in der Grafik beibehalten werden. Die Distanz der Achsenbeschriftung muss einheitlich sein, die Achsenbeschriftung sollte bei null beginnen – ansonsten ist die Gefahr der Manipulation groß, da Unterschiede und Trends dramatisiert oder verharmlost werden können
-
3D-Darstellungen sind zu vermeiden, da sie häufig nicht die Lesbarkeit der Grafik verbessern.
-
Farben, typografische Elemente und Formen können helfen, Akzente zu setzen und bestimmte Attribute in der Grafik Hervorzuheben
-
Farbnutzung: Farbabstufungen (ein-, maximal zweifarbig) bieten sich an, um die Verteilung intervallskalierter Variablen darzustellen. Für ordinalskalierte Variablen sollten unterschiedliche Farben genutzt werden (maximal 7). Die gewählten Farben (zum Beispiel für Geschlecht) sollten im gesamten Bericht beibehalten werden. Unterschwellig vorherrschende Farbkonnotationen können helfen, die Lesbarkeit der Grafik zu verbessern – zumindest sollten sie nicht vertauscht werden. Verschiedene Onlinetools helfen, Farben so zu wählen, dass sie auch bei Farbblindheit unterschieden werden können. Bei der Farbwahl ist zu bedenken, dass Rot oft als Warnung verstanden wird. Um bestimmte Darstellungen nicht zu dramatisieren, empfehlen sich eher neutrale Farbabstufungen
-
Vorsicht ist geboten bei voreingestellten Standards der Programme, mit denen Grafiken erstellt werden. Häufig beinhalten diese Standardeinstellungen Überflüssiges, oder relevante Elemente fehlen. Grafiken sollten deshalb an die jeweiligen Bedarfe angepasst und vor Aufnahme in den Bericht aufgeräumt werden. Folgende Fragen können dabei gestellt werden: Sind Gitternetzlinien notwendig oder können sie heller eingefärbt werden? Müssen die Achsen dargestellt werden oder sollte die Achsenbeschriftung angepasst werden, um die Lesbarkeit zu verbessern? Ist es sinnvoll, die Datenbeschriftung (gegebenenfalls auch nur punktuell) einzufügen? Werden Farben so genutzt, dass sie die Leserinnen und Leser an die richtige Stelle lenken und Wichtiges hervorheben? Ist es hilfreich, Erläuterungen in die Grafik einzufügen (zum Beispiel Hinweise in Zeitreihen bezüglich geänderter gesetzlicher Vorgaben)? Wäre es hilfreich, die Kernaussage der Grafik in der Überschrift zu platzieren, um Leserinnen und Leser auf relevante Muster hinzuweisen?
Bei kartografischen Darstellungen sind weitere besondere Aspekte zu beachten, die detailliert in der Publikation „Gute Kartographische Praxis im Gesundheitswesen“ erläutert werden (Augustin et al. 2017). Einige Aspekte werden an dieser Stelle exemplarisch aufgeführt:
-
Auswahl/Festlegung der darzustellenden Raumeinheiten und die Auswahl der geeigneten Kartengrundlage: Kartengrundlagen können beispielsweise im Geoportal des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie abgerufen werden
-
Auswahl des Kartentyps: Man unterscheidet je nach darzustellendem Datentyp Diagrammkarten für quantitative, absolute Daten; Choroplethenkarten (Flächendichtekarten) für quantitative, relative Daten und Standortkarten für qualitative Daten. Darüber hinaus gibt es mehrschichtige Daten, die verschiedene Kartentypen vereinen
-
Farbgebung: Beim Einsatz von Farben sollte deren Assoziation berücksichtigt werden (zum Beispiel Rot für Gefahr), da hierdurch die Aussage einer Karte beeinflusst werden kann. Quantitative Daten sind durch die Variation der Helligkeit einer Farbe wiederzugeben. Bei vielen Klassen kann zusätzlich der Farbton verändert werden. Daten mit positiven und negativen Wertebereichen oder einem Schwellenwert können in einer bipolaren Farbreihe dargestellt werden. Für die Randklassen werden Komplementärfarben genutzt
-
Klassifizierung: Es gibt verschiedene Methoden, die Daten für die kartografische Darstellung zu klassifizieren. Gebräuchliche Verfahren zur Klassenzuordnung sind vor allem konstante Breite, (äquidistante) Klassen und Quantile sowie Standardabweichungen
-
Legende und Kartenbeschriftung: Sie können als erläuternde Elemente eingefügt werden.
4.3. Wie erreicht die GBE einen Impact?
Natürlich möchte die GBE den Grundstein für faktenbasierte und möglichst evidenzinformierte Entscheidungen legen. Aber nicht immer erwachsen aus Berichten umfassende Modifikationen, die dann auch noch messbar zu einer Veränderung der gesundheitlichen Lage führen. Aber es gibt Zwischenschritte, die ebenfalls einen Impact der GBE zum Ausdruck bringen (Rosenkötter et al. 2020):
-
die Stärke und Breite der Resonanz nach Veröffentlichung von Gesundheitsberichten oder anderen GBE-Produkten, - die Berücksichtigung der Ergebnisse der GBE in weiteren Planungsprozessen,
-
die Entwicklung von Strukturen oder Gremien zu einem in der Berichterstattung hervorgehobenen Sachverhalt,
-
die Bereitstellung von Fördermitteln zur Umsetzung der abgeleiteten Handlungsempfehlungen,
-
die Etablierung konkreter Maßnahmen und Programme basierend auf den Handlungsempfehlungen der GBE.
Der Impact der GBE hängt auch davon ab, ob alle wesentlichen Aspekte, die den Impact beeinflussen, bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden (siehe auch Kapitel 7). Dazu gehören die politische und strategische Relevanz des Berichts, die sinnvolle Integration unterschiedlicher Daten (innerhalb des Gesundheitsbereichs, aber auch ressortübergreifend), die Zuverlässigkeit der Ergebnisse, die Qualität der Interpretation der Daten, die wissenschaftliche Basis der dargestellten Inhalte, die nachvollziehbare Darstellung von Bedarfen, die lösungsorientierte Darstellung von Handlungsfeldern und Handlungsoptionen, die kontinuierliche Interaktion mit den Adressatinnen und Adressaten auch während der Berichterstellung, der Zeitpunkt der Veröffentlichung im politischen Prozess, das Marketing des Berichts und die breite Nutzbarkeit der Ergebnisse (van Bon-Martens et al. 2019; Rosenkötter et al. 2020).
4.3.1. „Vermarktung“ der GBE – Pressearbeit und Kommunikation
Auch wenn die GBE kein Produkt im klassischen Sinne ist, muss sie doch in ähnlicher Weise verbreitet und bekannt gemacht werden, um wirksam zu sein. Die Vermarktungsstrategie kann anhand der sieben Marketingkriterien (7 Ps) von Boom und Bitner entwickelt werden (zit. nach van Bon-Martens et al. 2019). Für die GBE sind allerdings nur sechs der sieben Kriterien relevant, das siebte Kriterium, der Preis, spielt in der GBE in der Regel keine Rolle, da die Produkte üblicherweise kostenfrei zur Verfügung stehen. Im Folgenden werden die sechs Kriterien benannt und beispielhaft Fragen gelistet, die für die Entwicklung einer Vermarktungsstrategie relevant sein können:
-
Produkte (Products): Wäre es sinnvoll, Ihren Bericht durch andere Produkte wie kurze Videos oder Infografiken zu ergänzen oder eine spezifische Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger, andere Interessengruppen oder eine Laienversion Ihres Berichts zu entwickeln? Haben Sie Veröffentlichungen anderer Organisationen angesehen? Gibt es – was das Erscheinungsbild und das Layout betrifft – etwas Inspirierendes für Sie, das Ihren Bericht ansprechender und moderner macht?
-
Werbung (Promotion): Wie werden Sie die Öffentlichkeit über den Bericht informieren? Wie informieren Sie interessierte Kolleginnen und Kollegen? Wie die Fachöffentlichkeit? Wird es eine Pressekonferenz geben oder bereiten Sie in Abstimmung mit der Pressestelle Ihrer Kommune eine Pressemitteilung vor? Ist der Einsatz von Social Media sinnvoll? Wenn ja, entwickeln Sie einen informativen Newsfeed mit dem Link zu Ihrem Bericht, aussagekräftigen Zahlen und relevanten inhaltlichen Informationen!
-
Veröffentlichungsort (Place): Überlegen Sie, wo der Bericht zu finden ist. Kann er im Bestellsystem für gedruckte Broschüren des Kreises/der Stadt, der Seite Ihres Amtes oder einer speziellen Seite mit Produkten der GBE gefunden werden? Es sind verschiedene Orte für die Veröffentlichung möglich. Denken Sie über einen Ort nach, der am besten zu den Gewohnheiten und dem Kontext in Ihrem Verwaltungsbezirk passt.
-
Personen (Persons): Unterschätzen Sie nicht die Relevanz der Personen, die den Bericht geschrieben haben. Obwohl die Stadt oder der Kreis normalerweise als Herausgeber fungiert, könnte es hilfreich sein, renommierte und gut vernetzte Personen im Autorinnen- und Autorenteam zu haben. Der Ruf des Autorinnen- und Autorenteams trägt dazu bei, wie der Bericht wahrgenommen wird. Darüber hinaus ist es hilfreich, wenn Mitglieder des Teams die Inhalte des Berichts im Rahmen von Vorträgen überzeugend darstellen können.
-
Verbreitung (Process of Delivery): Ganz allgemein ist es ratsam, verschiedene Kanäle für die Verbreitung zu nutzen: die Medien, die interessierte Fachöffentlichkeit, relevante Zielgruppen (je nach Inhalt des Berichts kann es hilfreich sein, nicht nur über Akteurinnen und Akteure im Gesundheitsbereich nachzudenken, vielleicht ist Ihr Bericht ebenso aus sozialpolitischer, bildungspolitischer oder stadtplanerischer Sicht interessant), Gesundheitskonferenzen, persönliche berufliche Kontakte. Denken Sie aber auch über den Zeitpunkt der Veröffentlichung nach, zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb der Legislaturperiode oder in Verbindung mit einem anderen wichtigen Ereignis (Window of Opportunity).
-
Umfeld (Physical Evidence): Wenn Sie eine Gesamtbewertung in Bezug auf die Veröffentlichung und Verbreitung des Berichts vornehmen: Macht alles einen professionellen und zuverlässigen Eindruck, sprich die Produkte, der Veröffentlichungsort, die beteiligten Personen?
4.3.2. Methodisch-fachliche Qualifikation
Die methodisch-fachlichen Anforderungen an Berichterstatterinnen und Berichterstatter sind hoch, weshalb eine Grundqualifikation im Bereich der Gesundheits- und Sozialwissenschaften oder in angrenzenden Fachgebieten sinnvoll ist. Gesundheitsberichterstattung bedeutet – wie dieses Kapitel aufzeigt – den Umgang mit (gesundheitsbezogenen) Daten. Eine gewisse Affinität zu Zahlen ist ebenso von Vorteil wie ein ganzheitliches Grundverständnis von Gesundheit. Wenn Gesundheitsberichterstattung als Mehrwert aufgefasst wird und nicht als bloßes Zusammenstellen von Datentabellen aus verschiedenen Datenquellen, sind weitreichende Kenntnisse epidemiologischer und sozialwissenschaftlicher Methoden notwendig. Das Verständnis epidemiologischer Kennzahlen, die die Verteilung von Gesundheit in der Bevölkerung und deren Determinanten aufzeigen (Rothman et al. 2008), ist das vornehmliche Handwerkszeug, selbst wenn „nur“ Daten aus vorhandenen Quellen für die Berichterstellung verwendet werden. Es ist die Voraussetzung, bereitgestellte Daten aus Abteilungen des Gesundheitsamtes, von eigenen Statistikstellen oder von Landes- oder Bundesbehörden zu verstehen, zu interpretieren und anderen erklären zu können. Die adressaten- und adressatinnengerechte Beschreibung und (grafische) Aufbereitung der Daten erfordert die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu durchdringen, um diese so darstellen zu können, dass sie für Rezipienten und Rezipientinnen verstehbar sind. Das Erstellen von Grafiken und Karten, die sich in der GBE aufgrund ihrer vermeintlichen Einfachheit und Klarheit großer Beliebtheit erfreuen, sollte im Vorfeld gut bedacht werden. Die Wirkung von Bildern in Form von Grafiken oder Karten darf nicht unterschätzt werden. Eine intensive Auseinandersetzung mit der Aussagekraft der Daten und den oben genannten Empfehlungen ist zwingend notwendig.
Sobald eigene Daten mit Daten anderer Ressorts oder Sektoren integriert werden, sind unter anderem sozialepidemiologische, arbeitssoziologische, planerische oder umweltbezogene Kenntnisse notwendig, um sinnvolle Verknüpfungen zu erstellen (siehe auch Kapitel 5). Hier ist es ratsam, die Berichterstattung als interaktiven Prozess im Austausch mit anderen Experten und Expertinnen zu verstehen (siehe auch Kapitel 6). Interdisziplinäres, vernetztes Agieren als Arbeitsmethode und das Einlassen auf neue Themen muss für Gesundheitsberichterstatterinnen und Gesundheitsberichterstatter selbstverständlich und gewollt sein.
Neben diesen methodisch-fachlichen Kompetenzen sind Kenntnisse des Verwaltungshandelns und -aufbaus (siehe auch Kapitel 3) relevant, um beispielsweise notwendige Abstimmungsprozesse im Verlauf des Prozesses zu initiieren.
Für Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen in den Bereich der Berichterstattung gibt es Fortbildungsangebote der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, die von der Einführung in die Berichterstattung bis zur Vertiefung statistischer Methoden reichen. Die Inhalte der Fortbildungen orientieren sich an Bedarfen und Bedürfnissen der Berichterstatterinnen und Berichterstatter ebenso wie an der stetigen Weiterentwicklung der GBE. Teilweise organisieren sich die GBEler und GBElerinnen mit Unterstützung des Landesgesundheitsamtes auch selbst, um regelmäßig fachlich-kollegiale Beratung zu ermöglichen, da sie in ihren Ämtern oft als Einzelkämpfer unterwegs sind (zum Beispiel Arbeitskreis Qualitätssicherung in der GBE in Baden-Württemberg oder die Fachtagung Kommunale GBE in Nordrhein-Westfalen).
4.4. Weiterführende Informationen
Datengrundlage der GBE
-
Gothe, H et al. (Hg.) (2014): Routinedaten im Gesundheitswesen. Handbuch Sekundärdatenanalyse: Grundlagen, Methoden und Perspektiven. 2., vollst. überarb. u. erw. Aufl. Bern: Verlag Hans Huber.
-
LGL (2006): Datenquellen der Gesundheitsberichterstattung für die Landkreise und kreisfreien Städte Bayerns. Erlangen.
-
Szagun, B (2006): Kennwerte wählen. In: Reintjes, R; Klein, S (Hg.): Gesundheitsberichterstattung und Surveillance. Messen, Entscheiden und Handeln. Bern: Hans Huber.
Methodenkenntnisse in der GBE
-
Kuhn, J; Wildner, M (2019): Gesundheitsdaten verstehen. Statistiken lesen lerne. Ein Einsteigerbuch. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bern: Hogrefe.
-
LGL (2008): Mediale Aspekte der Gesundheitsberichterstattung. Handlungshilfe. Erlangen.
-
LGL (2011): Gesundheitsberichterstattung für die Landkreise und kreisfreien Städte Bayerns. Erlangen.
-
LGL (2014): Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung. Begriffe, Methoden, Beispiele. 2. Aufl. Erlangen.
GBE und Impact
-
Albrich, C; Brandeis, B; Erb, J et al. (2017): Handlungsempfehlungen für den Aufbau einer Gesundheitsplanung im Öffentlichen Gesundheitsdienst. Ergebnisse eines Pilotvorhabens in Baden-Württemberg. Stuttgart.
-
LGL (2019): Von Daten zum Handlungsbedarf. Aufgreifkriterien für Daten aus der kommunalen Gesundheitsberichterstattung. Erlangen.
4.5. Literaturverzeichnis Kapitel 4. – GBE Handwerk
-
AOLG (2003): Indikatorensatz für die Gesundheitsberichterstattung der Länder. Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden. 3. Aufl. Hg. v. Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen. Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG). Düsseldorf.
-
Augustin, J; Kistemann, T; Koller, D; Lentz, S; Maier, W A; Moser, J; Schweikart, J (Hg.) (2017): Gute kartographische Praxis im Gesundheitswesen (GKPiG). Deutsche Gesellschaft für Geographie; Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie; Leibniz-Institut für Länderkunde. Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde (Forum IfL, Heft 32). Online verfügbar unter http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-52071-9, zuletzt geprüft am 15.08.2023.
-
Bardehle, D; Annuss, R; Hermann, S; Ziese, T; Böhm, K (2004): Der neue Länderindikatorensatz für die Gesundheitsberichterstattung. In: Bundesgesundheitsbl. (Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz) 47 (8), S. 762–770. DOI: 10.1007/s00103-004-0872-x.
-
Blessing, V; Davé, A; Varnai, P (2017): Evidence on mechanisms and tools for use of health information for decision-making. Hg. v. World Health Organization. Health Evidence Network (HEN). Copenhagen (Health Evidence Network (HEN) synthesis report, 54).
-
Cairo, A (2016): The truthful art. Data, charts, and maps for communication. Place of publication not identified: New Riders.
-
Cornelius-Taylor, B; Brand, H (2004): European public health reports between expectations and reality. In: Italian Journal of Public Health (IJPH), S. 13–21. DOI: 10.2427/6137.
-
Diekmann, A (2014): Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. 8. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
-
Eckert, O; Vogel, U (2018): Todesursachenstatistik und ICD, quo vadis? In: Bundesgesundheitsbl. (Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz) 61 (7), S. 796–805. DOI: 10.1007/s00103-018-2756-5.
-
Few, S (2012): Show me the numbers. Designing tables and graphs to enlighten. second edition. Burlingame, Calif.: Analytics Press.
-
Hamburger Projektgruppe Gesundheitsberichterstattung (Hg.) (1998): Praxishandbuch Gesundheitsberichterstattung. Ein Leitfaden für GesundheitsberichterstatterInnen und solche, die es werden wollen. 2. aktualisierte Aufl. Düsseldorf: Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen (Schriftenreihe, Band 18).
-
Institute of Medicine U.S. (Hg.) (1988): The Future of Public Health. Institute of Medicine. 12. Aufl. Washington, D.C.: National Academy Press.
-
Kurth, B M; Lange, C; Kamtsiuris, P; Hölling, H (2009): Gesundheitsmonitoring am Robert Koch-Institut. Sachstand und Perspektiven. In: Bundesgesundheitsbl. (Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz) 52 (5), S. 557–570. DOI: 10.1007/s00103-009-0843-3.
-
Nussbaumer Knaflic, C (2015): Storytelling with data. A data visualization guide for business professionals. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
-
RKI (2019): Studie zur Gesundheit älterer Menschen in Deutschland - Gesundheit 65+. Die Studie Gesundheit 65+ wird vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert (Förderkennzeichen: ZMVI1-2518FSB410). Laufzeit: 01.01.2019 bis 30.06.2023. Hg. v. Robert Koch-Institut (RKI). Online verfügbar unter https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/MonAge/MonAge_node.html, zuletzt geprüft am 15.08.2023.
-
Rosenkötter, N; Borrmann, B; Arnold, L; Böhm, A (2020): Gesundheitsberichterstattung in Ländern und Kommunen: Public Health an der Basis. In: Bundesgesundheitsbl. (Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz) 63, S. 1067–1075. DOI: 10.1007/s00103-020-03190-z.
-
Rothman, K J; Greenland, S; Lash, T L (2008): Modern epidemiology. 3. ed. Philadelphia Pa. u.a.: Wolters Kluwer [u.a.].
-
Santos-Hövener, C; Schmich, P; Schuhmann Maria; Gößwald, A; Rommel, A; Ziese, T; Lampert, T (2019): Improving the information base regarding the health of people with a migration background. Project description and initial findings from IMIRA. In: Journal of Health Monitoring 4 (1), S. 46–57. DOI: 10.25646/5874.
-
Saß, A-C; Gößwald, A; Ziese, T (2018): Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsmonitoring – Daten für Taten. In: Public Health Forum 26 (3), S. 266–270. DOI: 10.1515/pubhef-2018-0055.
-
Starke, D; Tempel, G; Butler, J; Starker, A; Zühlke, C; Borrmann, B (2019): Gute Praxis Gesundheitsberichterstattung – Leitlinien und Empfehlungen 2.0. In: Journal of Health Monitoring 4 (S1), S. 1–22.
-
Takla, A; Wichmann, O; Rieck, T; Matysiak-Klose, D (2014): Measles incidence and reporting trends in Germany, 2007–2011. In: Bulletin of the World Health Organization 92 (10), S. 742–749. DOI: 10.2471/BLT.13.135145.
-
van Bon-Martens, M; van Oers, H; Verschuuren, M (2019): Population Health Reporting. In: Verschuuren, M; van Oers, H (Hg.): Population Health Monitoring. Cham: Springer International Publishing, 107–125.
-
Verschuuren, M; Achterberg, P W; Kramers, P G N; van Oers, H: Monitoring the health of the population. In: Rechel, McKee (Hg.) 2014 – Facets of Public Health, S. 23–41.
-
Verschuuren, M; van Oers, H (Hg.) (2019): Population Health Monitoring. Cham: Springer International Publishing.